Baupreisgleitklauseln in Bauverträgen: So funktionieren sie und wo sie scheitern
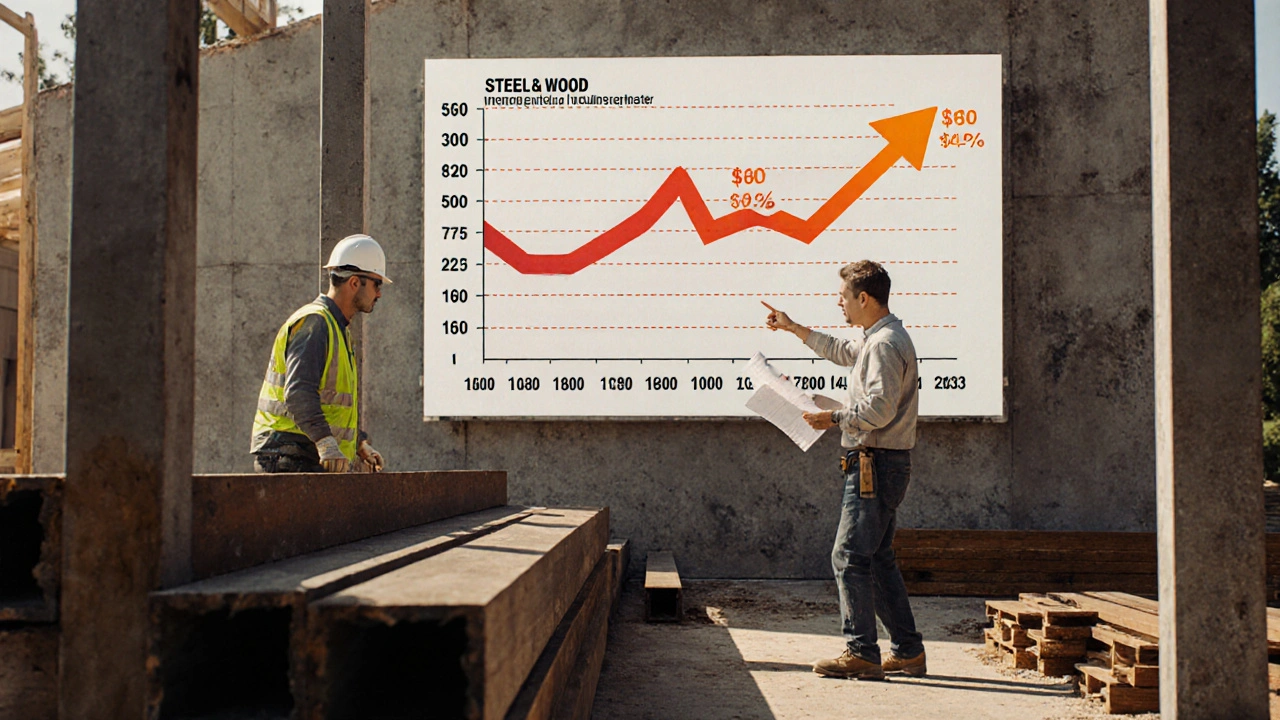 Nov, 16 2025
Nov, 16 2025
Stellen Sie sich vor: Sie unterschreiben einen Pauschalpreis für Ihren Neubau. Sechs Monate später steigt der Preis für Stahl um 40 %, Holz um 55 %, und die Löhne der Handwerker steigen aufgrund eines neuen Tarifvertrags. Plötzlich steht Ihr Bauunternehmen vor einem Problem - es muss den Vertrag einhalten, aber es verliert Geld. Was tun? Eine Baupreisgleitklausel kann das retten. Doch viele Bauherren verstehen sie nicht, und zu oft wird sie falsch formuliert - mit teuren Folgen.
Was ist eine Baupreisgleitklausel und warum braucht man sie?
Eine Baupreisgleitklausel ist eine vertragliche Regelung, die es ermöglicht, den ursprünglich vereinbarten Baupreis nachträglich anzupassen, wenn sich die Kosten für Materialien oder Löhne stark verändern. Sie ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit in Zeiten hoher Preisvolatilität. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden 2023 bereits 78 % aller deutschen Bauverträge mit einer solchen Klausel abgeschlossen - im Jahr 2019 waren es nur 45 %. Der Grund? Rohstoffpreise sind unberechenbar geworden.
Ein Beispiel: Ein Bauunternehmen hat im Januar 2023 einen Auftrag für 350.000 € erhalten. Im Juni 2023 steigen die Stahlpreise um 42 %, Holz um 58 %. Ohne Klausel muss das Unternehmen den Vertrag trotz Verlusten erfüllen. Mit einer korrekt formulierten Preisgleitklausel kann es die Kosten anpassen - und bleibt wirtschaftlich überlebensfähig.
Doch es gibt zwei Arten: Die Materialgleitklausel (auch Stoffpreisgleitklausel) greift bei Veränderungen von Baustoffen wie Stahl, Holz, Beton, Dämmmaterialien oder Energiekosten. Die Lohngleitklausel berücksichtigt tarifliche Lohnerhöhungen - aber nur die, die für alle Mitarbeiter gelten. Überstunden, Sonderzahlungen oder individuelle Boni zählen nicht.
Wie wird eine Preisgleitklausel richtig aufgebaut?
Eine gute Klausel ist wie ein Bauplan: Jedes Detail zählt. Wer sie nur mit „Preise können angepasst werden“ formuliert, macht sich strafbar - und lädt Streit ein. Laut dem Deutschen Anwaltverein waren 34 % aller Bau-Streitfälle 2022 auf schlecht formulierte Klauseln zurückzuführen.
Die korrekte Formulierung muss fünf Elemente enthalten:
- Welche Kostenarten? Nur Material und Löhne - nicht Transport, Versicherung oder Bürokratiekosten.
- Ab welcher Schwelle? Meist 5 % oder 7 % Preisveränderung. Darunter bleibt der Preis unverändert.
- Welcher Bezugspunkt? Der Preis zum Vertragsabschluss - nicht zum Zeitpunkt der Bestellung oder Lieferung.
- Welche Berechnung? Entweder ein offizieller Index (z. B. Baukostenindex des Statistischen Bundesamts) oder eine mathematische Formel.
- Wann wird angepasst? Nach Fertigstellung? Nach jeder Bauphase? Nach Materiallieferung?
Die gängigste Formel lautet: P = a × P0 + b × P0 × (M1/M0) + c × P0 × (L1/L0)
- P = neuer Preis
- P0 = ursprünglicher Preis
- M0 und M1 = Materialkosten zu Beginn und am Ende
- L0 und L1 = Lohnkosten zu Beginn und am Ende
- a, b, c = Gewichtungsfaktoren in Prozent (z. B. a = 30 %, b = 50 %, c = 20 %)
Ein Bauunternehmer, der einen Pauschalpreis von 400.000 € vereinbart hat, mit 30 % fixe Kosten, 50 % Material und 20 % Lohn, könnte bei einer 40 %igen Steigerung der Materialkosten und 8 % Lohnsteigerung eine Preisanpassung von 20.000 € bis 25.000 € erhalten - je nach genauer Formel.
Index oder Formel? Was ist besser?
Es gibt zwei Wege: Der eine ist der Index, der andere die Formel.
Ein Index ist einfach: Der Baukostenindex (BKI) des Statistischen Bundesamts wird monatlich veröffentlicht. Wenn der Index von 115 auf 125 steigt, ist das eine Steigerung von 8,7 %. Der Vorteil: Er ist transparent, offiziell und schwer zu manipulieren. Der Nachteil: Er ist ein Durchschnittswert - er passt nicht immer zu den tatsächlichen Materialien Ihres Projekts. Holzpreise können stärker steigen als der Durchschnitt, Stahl viel stärker.
Die Formel ist präziser. Sie kann spezifische Materialien wie Holz, Stahl oder Dämmplatten einzeln berücksichtigen. Sie braucht aber genauere Daten. Wer eine Formel nutzt, muss dokumentieren, woher die Preise kommen - Rechnungen, Lieferantenlisten, Preislisten vom VHB oder von Fachverbänden. Ohne Nachweis ist die Anpassung ungültig.
Die Österreichische Wirtschaftskammer (WKO) bietet einen kostenlosen Online-Preisumrechner an, der nach ÖNORM B 2111 rechnet. In Deutschland werden die Formblätter 224 und 225 des VHB-Bundes von 85 % der Unternehmen genutzt - sie sind die Standardvorlage.

Wann greift die Klausel - und wann nicht?
Die Klausel ist kein Freifahrtschein. Sie hat klare Grenzen.
- Nicht erlaubt: Überstunden, Sonderzahlungen, Ersatzteile, Transportkosten, Baustellenlogistik, Versicherungen, Büro- oder Projektmanagementkosten.
- Nicht erlaubt: Preissteigerungen, die bereits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses absehbar waren. Wer im Januar 2023 wusste, dass die Stahlpreise steigen werden, kann nicht später eine Klausel nutzen, um den Verlust abzufedern.
- Nicht erlaubt: Nachträgliche Einführung. Die Klausel muss beim Vertragsabschluss vereinbart werden. Wer sie später „nachträglich“ einfügt, macht den Vertrag ungültig - und riskiert eine Klage wegen Betrug.
Ein Fall aus der Praxis: Ein Bauherr lehnte eine Preisanpassung ab, weil der Unternehmer die Kostensteigerung nur mit einer E-Mail-Bestätigung vom Lieferanten belegte. Das Gericht entschied: Kein offizieller Nachweis, keine Anpassung. Der Unternehmer musste den Verlust tragen.
Privat vs. öffentlich: Wer akzeptiert was?
Es macht einen großen Unterschied, ob Sie als Privatperson bauen oder die Stadt.
Bei öffentlichen Auftraggebern - Kommunen, Behörden, Bundesländer - ist die Klausel Standard. Die VOL/B § 17 schreibt sie sogar vor. Die Akzeptanzrate liegt bei 89 %. Die Verwaltung hat Erfahrung, Rechtsabteilungen und klare Verfahren. Sie versteht, dass Preissteigerungen nicht vermeidbar sind.
Bei privaten Bauherren ist es anders. Nur 67 % akzeptieren Preisanpassungen - und viele lehnen sie ab, weil sie die Berechnung nicht verstehen. Eine Studie der TU München ergab: 42 % der privaten Bauherren lehnen die Anpassung ab, weil die Nachweise nicht „transparent“ genug sind. Sie sehen eine Rechnung mit Zahlen, aber nicht, wie sie zustande kommen.
Das Problem: Der Bauherr glaubt, er zahlt „zu viel“. Der Unternehmer fühlt sich betrogen. Beide haben recht - aber nur, wenn die Klausel richtig war. Wer sie nicht versteht, sollte sie nicht unterschreiben. Es gibt keine „einfache“ Version. Wer sagt „Das ist doch nur eine Kleinigkeit“, riskiert später einen langen Rechtsstreit.

Was passiert, wenn die Klausel falsch ist?
Ein falsch formulierter Vertrag ist kein Vertrag - er ist eine Zeitbombe.
Wenn die Klausel unklar ist, kann sie vom Gericht für nichtig erklärt werden. Dann trägt der Unternehmer das Risiko - und verliert Geld. Oder der Bauherr zahlt mehr, als er sollte - und klagt später auf Rückerstattung.
Das OLG Düsseldorf entschied 2022: Eine Klausel ist wirksam, wenn sie transparent und nachvollziehbar ist. Keine vagen Formulierungen. Kein „sofern möglich“. Kein „nach billigem Ermessen“. Nur klare Zahlen, klare Indizes, klare Dokumentation.
Ein weiteres Risiko: Die Dokumentation. Wer die Preise nicht mit Rechnungen, Lieferpapieren und Preislisten belegt, hat verloren. Die durchschnittliche Fehlerquote bei manueller Berechnung liegt bei 22 %. Mit Software sinkt sie auf 4 %. Die meisten großen Bauunternehmen nutzen heute spezielle Programme wie DATEX - sie ziehen automatisch aktuelle Indizes aus dem Statistischen Bundesamt und berechnen die Anpassung in Echtzeit.
Was ändert sich 2025? Nachhaltigkeit wird zum Problem
Die Zukunft der Preisgleitklauseln ist komplexer. Der Markt verändert sich.
Bis 2025 soll laut dem Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) jede Preisgleitklausel auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Was heißt das? Grüner Stahl, recyceltes Holz, CO2-arme Betonmischungen - diese Materialien haben heute noch keine offiziellen Preisindizes. Wie misst man den Preisunterschied zwischen „normal“ und „nachhaltig“? Wer bezahlt den Aufschlag? Wer trägt das Risiko, wenn nachhaltige Materialien teurer werden?
Ein weiterer Trend: Die Digitalisierung. Ab 2024 können neue Softwarelösungen nicht nur historische Indizes nutzen, sondern auch Prognosemodelle einbinden. Das heißt: Die Klausel passt sich nicht nur an, was passiert ist, sondern auch an, was wahrscheinlich passieren wird. Das ist innovativ - aber auch riskant. Wer setzt die Prognose fest? Wer haftet, wenn sie falsch liegt?
Was tun, wenn Sie bauen?
Wenn Sie als Bauherr einen Vertrag unterschreiben:
- Lesen Sie die Klausel - nicht nur unterschreiben.
- Verlangen Sie eine Erklärung: „Was genau wird angepasst? Wie wird gerechnet? Woher kommen die Zahlen?“
- Verlangen Sie ein Beispiel: „Wenn Stahl um 10 % steigt, wie viel mehr zahle ich dann?“
- Prüfen Sie, ob Formblatt 224 oder 225 des VHB-Bundes verwendet wird - das ist ein guter Anhaltspunkt.
- Wenn Sie unsicher sind: Holen Sie einen Bauanwalt hinzu. Einmal 200 € bezahlen - statt später 20.000 € verlieren.
Wenn Sie als Unternehmer vertraglich arbeiten:
- Verwenden Sie immer die offiziellen Formblätter.
- Verwenden Sie Software - nicht Excel.
- Dokumentieren Sie jede Preisänderung mit Rechnung, Liefertermin, Materialbezeichnung.
- Erklären Sie dem Bauherrn die Klausel - schriftlich, mit Beispielrechnung.
- Setzen Sie die Klausel nicht nachträglich durch - das ist rechtlich riskant.
Preisgleitklauseln sind kein Mittel, um Gewinne zu maximieren. Sie sind ein Schutz - für beide Seiten. Wer sie richtig nutzt, baut Vertrauen. Wer sie falsch nutzt, baut Streit.
Ist eine Baupreisgleitklausel Pflicht?
Nein, sie ist nicht gesetzlich vorgeschrieben - aber sie ist in der Praxis fast unverzichtbar. Bei öffentlichen Aufträgen schreibt die VOL/B § 17 sie vor. Bei privaten Bauverträgen ist sie freiwillig, aber hoch empfohlen. Ohne sie trägt der Unternehmer das volle Risiko von Preissteigerungen - was viele Unternehmen nicht mehr verkraften.
Kann ich die Klausel nachträglich einfügen?
Nein. Eine Preisgleitklausel muss zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung vereinbart werden. Nachträgliche Einfügung gilt als Vertragsänderung - und erfordert die Zustimmung beider Parteien. Wer sie ohne Zustimmung einfügt, macht den Vertrag ungültig und kann strafrechtlich belangt werden.
Was passiert, wenn der Bauherr die Preisanpassung ablehnt?
Wenn die Klausel korrekt formuliert und dokumentiert ist, hat der Bauherr keine rechtliche Möglichkeit, die Anpassung zu verweigern. Der Unternehmer kann die Preisanpassung schriftlich anfordern. Wenn der Bauherr trotzdem nicht zahlt, kann der Unternehmer die Zahlung vor Gericht einklagen. In der Praxis führt das oft zu langwierigen Prozessen - deshalb ist Transparenz und Kommunikation entscheidend.
Kann eine Klausel auch bei Preisrückgängen wirken?
Ja - aber nur, wenn sie beidseitig formuliert ist. Die meisten Klauseln sind einseitig: Nur bei Steigerungen wird angepasst. Doch es ist möglich, sie so zu gestalten, dass auch bei Preisrückgängen (z. B. bei einem Einbruch der Holzpreise) der Bauherr eine Kostensenkung erhält. Das ist fairer, aber seltener. Viele Unternehmer lehnen es ab, weil sie Angst vor Verlusten haben.
Wie beweise ich eine Kostensteigerung?
Mit originalen Rechnungen, Lieferpapieren und Preislisten von zugelassenen Quellen - wie dem Statistischen Bundesamt, dem VHB-Bundes oder den Herstellern. Eine E-Mail vom Lieferanten reicht nicht. Der Nachweis muss nachvollziehbar, zeitlich genau und auf das konkrete Material bezogen sein. Wer keine Dokumentation hat, hat keine Anpassung.